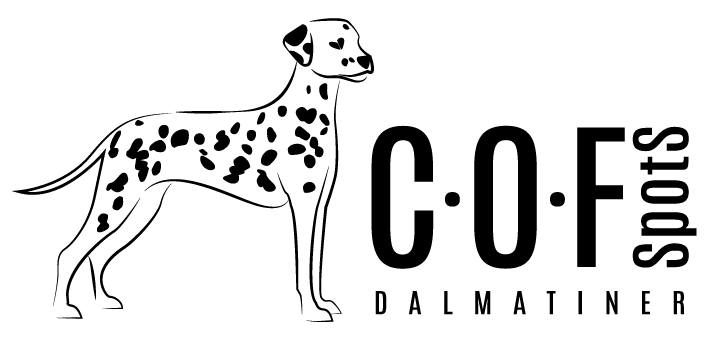Eine Entscheidung fürs Leben – und für die Gesundheit deines Hundes.
dieses Thema liegt mir besonders am Herzen. Die Frage, ob ein Hund kastriert werden sollte oder nicht, begegnet mir immer wieder – und jedes Mal wünsche ich mir, dass mehr Menschen sich ehrlich und intensiv mit den Auswirkungen dieses Eingriffs beschäftigen.
Vorweg möchte ich ganz klar sagen:
Ich bin kein grundsätzlicher Gegner medizinisch notwendiger Kastrationen.
Wenn es gesundheitliche Gründe gibt – wie etwa Tumore, Gebärmuttervereiterung (Pyometra) oder andere schwerwiegende Diagnosen –, dann ist die Kastration oft lebensrettend. Aber ich bin eine entschiedene Gegnerin der Kastration aus reiner Bequemlichkeit oder zur vermeintlichen Erleichterung der Erziehung.
Unsere Hunde sind fühlende Lebewesen mit einem ausgeklügelten hormonellen System, das Körper und Seele in Einklang hält. Und genau dieses System wird durch eine Kastration nachhaltig gestört – mit Folgen, die oft unterschätzt werden.
Natürliche Prozesse sind kein Makel
Viele Hündinnen zeigen während oder nach der Läufigkeit eine Scheinträchtigkeit – ein natürlicher, hormonell gesteuerter Zustand, der früher sogar eine lebenswichtige Funktion innerhalb eines Rudels hatte.
In freilebenden Hunderudeln – etwa bei Wölfen oder Straßenhunden – ist es in der Regel nur die ranghöchste Hündin, die sich fortpflanzt. Doch mehrere rangniedrigere Hündinnen entwickeln parallel eine Scheinträchtigkeit, obwohl sie selbst nicht trächtig sind. Warum?
Weil sie im Ernstfall als Ammen einspringen können.
Kommt es zu einer Komplikation bei der Alphahündin – z. B. bei der Geburt oder durch Krankheit – stehen die scheinträchtigen Hündinnen bereit, um die Welpen mit Milch zu versorgen und sie zu pflegen. Ihre hormonelle Umstellung bereitet sie genau darauf vor.
Scheinträchtigkeit ist also kein „Fehler der Natur“, sondern ein uraltes, intelligentes Sicherungssystem, das dem Überleben der Welpen dient. Eine Art Notfall-Plan der Natur, um das Rudel und seine Nachkommen zu schützen.
Wenn wir diesen natürlichen Vorgang medizinisch unterdrücken oder gar durch Kastration ausschalten, greifen wir tief in ein System ein, das über Jahrtausende gewachsen ist – oft, ohne die Folgen wirklich zu verstehen.
Auch bei unseren heutigen Haushunden steckt dieses Instinktverhalten noch tief verankert im Erbgut. Es verdient Verständnis, nicht Ablehnung.
Ein persönlicher Einblick – Freddy und Flocke
Auch ich habe Fehler gemacht. Als mein Herzenshund Freddy jung war, habe ich mich ohne großes Nachdenken zur Kastration entschieden. Ich vertraute damals auf gutgemeinte Ratschläge – wie etwa:
„Wenn du nicht züchten willst, dann kastrier ihn, bevor er einer läufigen Hündin hinterherläuft.“
Unsere Wohnlage – direkt an einer vielbefahrenen Straße – machte mir Sorgen. Die Angst, Freddy könnte weglaufen und verunglücken, ließ mich handeln. Und ja, Freddy hat die Kastration gut überstanden. Aber rückblickend war es Glück – nicht Wissen oder Weitsicht.
Meine Hündin Flocke hatte nicht so viel Glück. Nach einer schwierigen Geburt musste notfallmäßig operiert werden. Was ich nicht wusste: Während des Eingriffs wurden nicht nur die Gebärmutter, sondern auch die Eierstöcke entfernt. Flocke erholte sich körperlich, doch ihr Wesen veränderte sich drastisch.
Sie wurde unsicher, ängstlich, verlor ihren Rang im Rudel und wurde mehrfach von anderen Hunden angegriffen. Ihre Hormone fehlten – ihr Selbstverständnis, ihre Sicherheit, ihre Identität waren ins Wanken geraten. Das hat mir das Herz gebrochen.
Was viele nicht wissen: Kastration ist rechtlich eine Amputation
Nach § 6 des Tierschutzgesetzes sind operative Eingriffe wie das Kupieren von Ohren und Rute, das Entfernen der Wolfskralle und auch die Kastration ohne medizinischen Grund als Amputationen anzusehen – und somit verboten.
Die oft praktizierte „Vorsorge-Kastration“ bei jungen Hunden fällt rechtlich gesehen in eine Grauzone – moralisch jedoch ist sie für mich klar: nicht zu vertreten, solange keine medizinische Indikation vorliegt.
Die häufigsten Gründe – und warum sie keine Rechtfertigung sind
Bei Rüden:
- Markierverhalten
- Unruhe bei läufigen Hündinnen
- Jaulen, Nervosität, Aufreiten
Bei Hündinnen:
- Bluten während der Läufigkeit
- Einschränkungen in Spaziergang oder Alltag
- Scheinträchtigkeit
Aber all das gehört zur natürlichen Entwicklung eines Hundes.
Mit Verständnis, Geduld und Wissen lassen sich diese Phasen überstehen. Die Pubertät ist oft herausfordernd – das gilt für Hunde wie für Menschen. Aber ist das ein Grund, in ein sensibles System einzugreifen, das so viel mehr steuert als nur Sexualtrieb?
Die möglichen Folgen einer Kastration
Viele Nebenwirkungen einer Kastration zeigen sich nicht sofort – sie entwickeln sich schleichend:
- Übergewicht durch veränderten Stoffwechsel
- Harninkontinenz, v. a. bei großen Hündinnen
- Fellveränderungen, z. B. plüschiges „Welpenfell“ bei Langhaarrassen
- Verhaltensänderungen wie Unsicherheit, Aggression oder Apathie
- Wachstumsstörungen, v. a. bei Frühkastration
- Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation mit anderen Hunden
Unsere Hunde kommunizieren über Duftstoffe, Körpersprache und hormonelle Signale. Wer kastriert, nimmt ihnen ein wichtiges Kommunikationsmittel – mit Konsequenzen, die oft nicht bedacht werden.
Wann eine Kastration wirklich sinnvoll ist
Es gibt Situationen, in denen die Kastration die richtige Entscheidung ist – wenn sie dem Schutz des Hundes dient und medizinisch notwendig ist. Dazu zählen:
Bei Rüden:
- Hodenhochstand (Kryptorchismus)
- Hodentumore
- Prostataerkrankungen
- Perianalhernie
Bei Hündinnen:
- Gebärmutterentzündung (Pyometra)
- Eierstock- oder Gebärmuttertumore
- Dauerhafte Scheinschwangerschaften mit starker Belastung
- Vaginalvorfälle
In solchen Fällen ist es unsere Pflicht, schnell und verantwortungsvoll zu handeln – im Sinne des Tieres.
Sterilisation – eine sanfte Alternative zur Kastration
Verhütung ohne Eingriff in das hormonelle Gleichgewicht
Wenn es bei der Entscheidung um eine Operation in erster Linie darum geht, ungewollten Nachwuchs zu verhindern, lohnt sich der Blick auf eine oft vernachlässigte, aber sehr sinnvolle Möglichkeit: die Sterilisation.
Im Unterschied zur Kastration – bei der die Keimdrüsen (Hoden beim Rüden bzw. Eierstöcke bei der Hündin) vollständig entfernt werden – bleibt der Hormonhaushalt bei einer Sterilisation vollständig erhalten.
Was genau passiert bei einer Sterilisation?
- Beim Rüden werden die Samenleiter durchtrennt. Die Hoden bleiben erhalten, ebenso die Produktion von Testosteron. Der Rüde bleibt hormonell intakt – d. h., sein natürliches Verhalten, seine körperliche Entwicklung und seine Kommunikation mit anderen Hunden bleiben bestehen. Er kann zwar keine Spermien mehr weitergeben, aber er bleibt sexuell aktiv und instinktgesteuert.
- Bei der Hündin werden die Eileiter durchtrennt oder unterbunden. Auch hier bleiben die Eierstöcke erhalten, was bedeutet: Der Körper produziert weiterhin Östrogene und Progesteron. Die Hündin wird also weiterhin läufig, zeigt ggf. auch die damit verbundenen Verhaltensweisen, kann aber nicht mehr tragend werden.
Warum ist das wichtig?
Die Hormone, die bei Rüden und Hündinnen im Laufe ihres Lebens ausgeschüttet werden, haben weit mehr Aufgaben als nur die Steuerung der Fortpflanzung. Sie beeinflussen:
- das Wachstum und die Skelettreifung
- die Ausbildung von Muskulatur und Fell
- die emotionale Stabilität
- die soziale Kommunikation mit Artgenossen
- das Selbstbewusstsein und die Rangordnung im Rudel
Wenn durch eine Kastration diese Hormonproduktion unterbunden wird, kann das zu teils erheblichen körperlichen und psychischen Veränderungen führen – wie z. B. Übergewicht, Unsicherheit, Fellveränderungen oder Inkontinenz.
Die Sterilisation hingegen verhindert gezielt nur die Fortpflanzung, ohne den Hund aus seinem natürlichen hormonellen Gleichgewicht zu reißen. Sie ist daher vor allem für Halter eine gute Option, die keine Zucht planen, aber auch keine unnötigen Eingriffe in das natürliche Verhalten ihres Hundes möchten.
Ein fairer Kompromiss:
Die Sterilisation ist keine „kleine“ OP im Vergleich zur Kastration – sie ist ebenfalls ein chirurgischer Eingriff unter Vollnarkose. Aber sie ist weniger invasiv und vor allem langfristig schonender, wenn es um die Erhaltung des natürlichen Wesens und der körperlichen Balance des Hundes geht.
Natürlich bringt auch die Sterilisation gewisse Risiken mit sich – wie jeder operative Eingriff – doch sie verdient es, ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden, bevor man sich für eine vollständige Kastration entscheidet.
Entscheidet mit Herz – und mit Wissen
Ich möchte euch nicht vorschreiben, was richtig oder falsch ist. Aber ich bitte euch von Herzen:
Setzt euch ehrlich mit dem Thema auseinander. Stellt nicht eure Bequemlichkeit über das Wohlergehen eures Hundes.
Begleitet eure Tiere in ihrer Entwicklung, auch durch anstrengende Phasen. Holt euch Unterstützung bei erfahrenen Trainern, bei Fachleuten, bei anderen Haltern – aber denkt daran: Jeder Eingriff ins Leben eures Hundes sollte wohlüberlegt und begründet sein.
Kastration ist kein Allheilmittel. Es ist ein Eingriff in ein funktionierendes, fein abgestimmtes System – und sollte nur dann erfolgen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
Bleibt neugierig, hinterfragt, und entscheidet mit Verantwortung und Liebe.
Denn unsere Hunde schenken uns ihr Vertrauen – wir schulden ihnen Achtsamkeit.
Für Hundebesitzer, die das Gefühl haben, dass ihr Vierbeiner hormonell etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist und sich sanfte Unterstützung wünschen, kann ich das Produkt Liebestoll von der Firma MyCani wärmstens empfehlen.